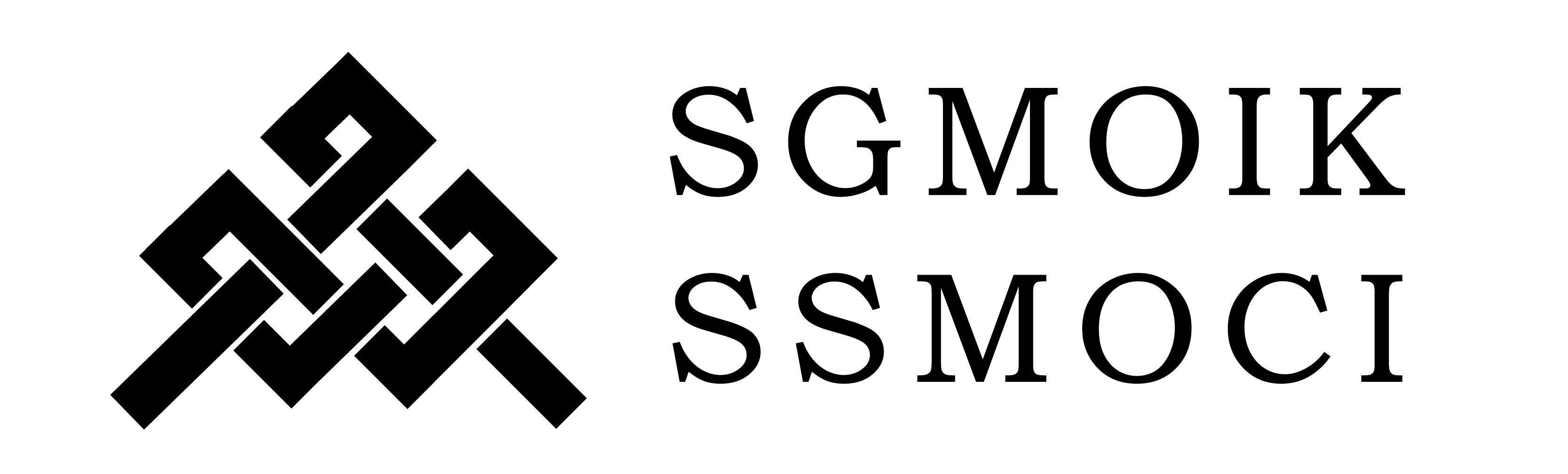Von Meret Michel
Mohammad erinnert sich noch genau an den Tag, an dem er als Kind zum ersten Mal das Stadtzentrum Beiruts besuchte. Ein Bekannter seines Vaters besaß ein Auto und versprach, ihn auf eine Fahrt in die Innenstadt mitzunehmen. Sie fuhren los, über die Schnellstraße Richtung Downtown. Mohammad sah die dichten Wohnhäuser vorbeifliegen, bis sie die luxuriösen Gebäude im Zentrum erreichten. »Ich sah mir das alles an und dachte mir: Das alles existiert hier?«
Er liebe Beirut, sagt Mohammad. Doch es ist eine einseitige Liebe: »Die Leute akzeptieren dich nicht, wenn du sagst, du kommst aus dem Lager«, sagt Mohammad, der seinen vollen Namen für sich behalten will. »Es stimmt, dass wir Teil dieses Landes sind. Aber letztlich sind wir hier Fremde.«
Mohammad, 33 Jahre alt, ist Palästinenser. Er ist in Schatila aufgewachsen, einem von drei palästinensischen Flüchtlingslagern in Beirut. Die Viertel um das Lager herum sind dichtes Stadtgebiet, hohe Wohnblocks säumen die Straße. Von hier aus führt eine Gasse ins Lager hinein. Sofort werden die Wege so eng, dass die Autos unmöglich hindurchpassen. Leute auf Motorrädern versuchen, sich einen Weg durch die Menschen zu bahnen. Die Stockwerke der unverputzten Backsteinhäuser ragen wie gestapelte Bauklötze in die Höhe.
Hier lebt Mohammad mit seiner Frau und seiner Tochter, in einer Wohnung in der Nähe des Lagereingangs. Eine unverputzte Betontreppe führt am Gebäude hoch, bis man die Wäscheleinen, die in der davorliegenden Gasse vor den Fenstern hängen, von oben sieht. Die Eingangstür führt direkt ins Wohnzimmer, drei Sofas umrahmen den Raum. Dieser ist selbst tagsüber von weißem Neonlicht erleuchtet, Tageslicht dringt kaum ins Innere.
Abgetrennte Welten
Schatila ist 1949 entstanden, als Ansammlung von Zelten, die eine Gruppe von palästinensischen Flüchtlingen hier am südlichen Rand Beiruts aufgestellt hatten. Es war ein Jahr nach der sogenannten »Nakba« – der Katastrophe, wie die systematische Vertreibung Hunderttausender Palästinenser aus ihrer Heimat im Zuge der Staatsgründung Israels 1948 im Arabischen bis heute genannt wird. Über 100 000 von ihnen flohen damals in den Libanon, darunter Mohammads Grosseltern.
Sie stammen ursprünglich aus einem Dorf namens al-Khalsa, im Norden Galiläas, direkt an der heutigen Grenze zum Libanon. Davon ist nicht viel übriggeblieben: Nachdem die Bewohner geflohen waren, wurde es bis auf wenige Gebäude zerstört. Auf den Überresten von al-Khalsa wurde Kirjat Schmona errichtet – ein Ort, dessen Name in den letzten zwei Jahren, als der Krieg zwischen der Hisbollah und Israel herrschte, immer wieder in den Nachrichten zu hören war.
Dass Mohammads Vorfahren aus al-Khalsa stammen, sollte später in seinem Leben noch eine wichtige Rolle spielen. Seine Familiengeschichte, die von dem kleinen Dorf im Norden Galiläas über Beirut nach Libyen und wieder zurück nach Beirut führt, steht exemplarisch dafür, wie die Gründungen der modernen Nationalstaaten in der Region, die Schaffung der Grenzen zwischen den Ländern das Leben der Menschen, besonders der palästinensischen, bis heute bestimmt.
Vor 1948 war die Beziehung zwischen Galiläa und dem Süden Libanons eng. Viele Menschen aus dem Südlibanon arbeiteten in Palästina, für sie war die Stadt Haifa vertrauter als Beirut. Im Libanon kannte man die Palästinenser vor allem als wohlhabende Besucher: 50 Prozent der Touristen im Jahr 1947 kamen aus Palästina, sie füllten die Hotels in Ferienorten in den Bergen wie Safwar oder Bhamdun. Nach 1948 jedoch sollte sich dieses Bild radikal ändern.
Während jene Palästinenser, die 1948 nach Jordanien vertrieben wurden, nach wenigen Jahren eingebürgert wurden und jene in Syrien fast volle Bürgerrechte erhielten, wurden die Palästinenser im Libanon zu Aussätzigen gemacht. Hier, wo das politische System entlang konfessioneller Linien aufgebaut ist, wo die Identität der Bewohner sich zuerst an der Familie, der Konfession, dem Dorf orientiert und erst danach am Staat als Ganzes, blieben die Palästinenser, die ihre Heimat verloren hatten, Außenseiter. Sie wurden als Bedrohung gesehen für das fragile demografische Gleichgewicht, und es gab einen breiten Konsens, dass sich die Palästinenser nicht dauerhaft im Libanon niederlassen dürften.
In der Folge wurden sie nicht als Flüchtlinge behandelt, die Anspruch auf Schutz hatten, sondern fielen ab 1962 in die dritte von fünf Kategorien von Ausländern: Jene, die ohne Dokumente ihres Heimatlandes im Libanon lebten und hier eine Aufenthaltsbewilligung hatten. Für eine Stelle mussten sie sich wie alle anderen Nicht-Libanesen um eine Bewilligung vom Arbeitsministerium bemühen, zu zahlreichen Berufsgruppen hatten Palästinenser faktisch keinen Zugang.
Angelpunkt einer gespaltenen Gesellschaft
In der Schule war Mohammad stets einer der Besten seiner Klasse. Doch er fragte sich, was ihm dieser Schulabschluss bringen sollte, wo es ihm doch verboten war, in fast vierzig Berufsgruppen zu arbeiten. Seinen Eltern zuliebe machte er eine Ausbildung zum Elektriker – im Wissen, dass er keine Anstellung finden würde. Stattdessen begann er mit 16 Jahren, tageweise auf dem Bau oder als Handwerker zu arbeiten.
Lange bevor Mohammad auf der Welt war, in den Sechziger- und Siebzigerjahren, arbeitete sein Vater als Krankenpfleger. Es war eine Zeit, in der sich die Situation der Palästinenser im Libanon verändern sollte: Nach dem Sechstagekrieg 1967 erstarkte der palästinensische bewaffnete Widerstand gegen Israel unter dem Schirm der »Palästinensischen Befreiungsorganisation« (PLO) und mit Jassir Arafat an seiner Spitze. Als die PLO nach 1970 gezwungen war, Jordanien zu verlassen, kamen die palästinensischen Widerstandsgruppen in den Libanon.
An der Frage, wie man zur palästinensischen Sache insgesamt und dem bewaffneten Widerstand vom Libanon aus im Besonderen stand, spaltete sich die libanesische Gesellschaft. Während die Linken, die Panarabisten und die überwiegende Mehrheit der muslimischen Bevölkerung ihren Kampf gegen Israel vom Libanon aus voller Überzeugung unterstützten, sahen die rechtsnationalen christlichen Parteien und viele vor allem maronitische Christen die Präsenz der PLO als Besatzung ihres Landes an. Es war diese Bruchlinie, an der sich 1975 der Bürgerkrieg entzünden sollte.
Das Ereignis, das den Krieg auslöste, war ein Massaker, bei dem Milizionäre der christlichen Kata’ib auf einen Bus mit palästinensischen Passagieren schossen und zahlreiche Insassen töteten. Daraufhin brachen Kämpfe zwischen den zwei libanesischen Lagern aus: Auf der einen Seite stand die Libanesische Nationalbewegung, die den Umsturz des konfessionellen politischen Systems forderten. Auf der anderen Seite standen die rechtsnationalistischen christlichen Gruppen, die ebenjenes System, das die politische Dominanz der maronitischen Christen über alle anderen garantierte, erhalten wollten.
Die PLO versuchte sich zunächst rauszuhalten. Doch als die christlichen Milizen ein Jahr später die palästinensischen Lager im Osten Beiruts belagerten, war das nicht mehr möglich. Über Wochen hinweg wurden die Bewohner der Lager ausgehungert, die Belagerung mündete in Massakern in Karantina und Tell al-Zaatar, bei der christliche Milizionäre unter Führung der Kata’ib Hunderte Zivilisten tötete und die Überlebenden vertrieben. Auch Mohammads Eltern flohen aus Tell al-Zaatar nach Schatila.
Auch ausländische Staaten, allen voran Syrien und Israel, griffen in den Krieg ein. Eine entscheidende Wende kam 1982: Damals startete Israel eine Bodeninvasion im Libanon und drang in wenigen Tagen von Süden her Richtung Beirut vor. Die Armee belagerte und bombardierte über Wochen hinweg den Westen der Stadt, bis die PLO sich zum Abzug aus dem Land bereit erklärte.
Der Abzug markierte das Ende des palästinensischen Widerstands im Libanon. Für die Palästinenser im Land sollte er massive Folgen haben. Am 16. September marschierte die israelische Armee in Beirut ein, zwei Tage, nachdem der designierte Präsident Baschir Gemayel noch vor seiner Amtsübernahme ermordet worden war. Am selben Tag drangen christliche Milizionäre in Schatila und dem angrenzenden Sabra ein und massakrierten zwischen mehreren Hundert und mehreren Tausend Bewohner.
Die israelische Regierung stritt zunächst jegliche Verantwortung für das Massaker ab. Erst nachdem eine interne Kommission feststellte, dass die Milizionäre auf Befehl der israelischen Armee in das Lager eindrangen, um nach »Terroristen« zu suchen, sah sich der damalige Verteidigungsminister Ariel Sharon zum Rücktritt gezwungen. In den darauffolgenden Jahren bis zum Ende des Kriegs wurde Schatila, vor allem während des sogenannten »Kriegs der Lager« zwischen der Amal-Bewegung und Überresten der PLO, beinahe vollständig zerstört.
Das Schicksal und die «sieben Dörfer»
Mohammads Eltern hatten das Massaker in Sabra und Schatila nicht selbst miterlebt. Ende der Siebzigerjahre hatte die Familie entschieden, nach Libyen auszuwandern. Über zehn Jahre sollten sie dortbleiben. 1994, zwei Jahre nach Mohammads Geburt, kehrte die Familie in den Libanon zurück.
Hier hatte der Bürgerkrieg inzwischen geendet. Und die Lage der Palästinenser hatte sich verschlechtert. Viele Libanesen machten sie verantwortlich für den Krieg, wobei sie großzügig über die Bruchlinien innerhalb der libanesischen Gesellschaft hinwegschauten, die letztlich die tieferliegenden Ursachen dafür waren.
Zurück in Beirut wollte der Vater wieder in dem Altersheim arbeiten, wo er vor seiner Abreise angestellt gewesen war. »Dort fragten sie ihn, ob er inzwischen eingebürgert worden sei«, sagt Mohammad. Im selben Jahr hatte der damalige Ministerpräsident Rafik Hariri ein Dekret verabschiedet, das zahlreichen Menschen, die im Libanon ohne libanesische Staatsbürgerschaft lebten, die Einbürgerung ermöglichte.
Darunter waren auch die Geflüchteten aus den sogenannten »Sieben Dörfern«, einer Ansammlung von zwei Dutzend Dörfern im heutigen Israel direkt an der Grenze zum Libanon. Diese Dörfer, darunter auch al-Khalsa, waren 1920 von der französischen Mandatsmacht dem Gebiet des Großlibanon zugerechnet worden. Dank des Erlasses konnte sich ein Großteil von Mohammads Verwandtschaft einbürgern lassen. Nicht aber seine Familie: Nach ihrer Rückkehr bewarben sie sich zwar um die Staatsbürgerschaft – doch das Zeitfenster war bereits geschlossen worden.
Als der Vater die Frage die Klinikleitung verneinte, hiess es, man könnte ihn nicht einstellen. Inzwischen waren zahlreiche Berufsgruppen hinzugekommen, in denen Palästinenser nicht arbeiten dürften, darunter auch die Krankenpflege. »Am selben Tag zog mein Vater seinen Kittel aus und tauschte ihn gegen einen Overall«, sagt Mohammad. Er begann, als Bauarbeiter zu arbeiten. Später arbeitete er wieder als Krankenpfleger – allerdings selbstständig. Irgendwann laugte ihn dies körperlich so sehr aus, dass er gar nicht mehr arbeiten konnte.
Die Erfahrung seines Vaters hatte Mohammad geprägt. Als er in der Lage war, etwas Geld zur Seite zu legen, begann er, seine Eltern zu unterstützen. Diese lehnten seine Hilfe zunächst ab – es war ihnen unangenehm, dass ihr Sohn für sie aufkam. Dennoch ging Mohammad jeden Samstag auf den Markt. »Ich hatte keine Ahnung, was ich nehmen sollte«, sagt er. Daher nahm er einfach alles: Fisch, Fleisch, Geflügel, das er bei seinen Eltern in den Kühlschrank stellte.
2017 verlobte sich Mohammad, im selben Jahr fand er eine Stelle bei der UNRWA. Die ersten zwei Jahre dort hatte er noch keinen festen Arbeitsvertrag, sondern wurde tageweise bezahlt. Seine Frau und er lebten in einer winzigen Wohnung im Untergeschoss. Dort konnten sie die Ratten hören, die in den Rohren in den Wänden lebten.
Nach zwei Jahren gab ihm die UNRWA einen festen Arbeitsvertrag, und Mohammad suchte eine bessere Wohnung. Dabei war es für ihn keine Frage, dass er in Schatila bleiben würde. Obwohl er mit seinem Gehalt auch eine Wohnung außerhalb des Lagers vermocht hätte, wollte er hierbleiben. Hier war sein Zuhause.
Dabei geht es um mehr als Kindheitserinnerungen. Die Lager verkörpern die Verbindung der Palästinenser zu dem Land, das sie verloren haben. Viele Straßen tragen bis heute die Namen der Dörfer, aus denen ihre Vorfahren geflohen waren. »Palästina kennen wir nur aus dem Fernsehen und aus den Büchern in der Schule.« Im Libanon verkörpern die Lager den einzigen Ort, den sie als ihren eigenen bezeichnen können.
Doch sein Gefühl von Zugehörigkeit gegenüber Schatila sei nicht mehr dasselbe, sagt Mohammad. In den letzten Jahren zogen immer mehr Leute von außerhalb in die Lager. Syrische Geflüchtete, Gastarbeiter aus Bangladesch oder Pakistan, Libanesen, die sich die teuren Mieten anderswo in der Stadt kaum noch leisten konnten. 2017 ergab eine Untersuchung, dass der Anteil der Palästinenser im Lager noch bei knapp 30 Prozent lag. Gleichzeitig verlassen immer mehr Palästinenser die Lager, wenn sie die Gelegenheit haben.
Damit ging ein Teil der Identität der Lager verloren, sagt Mohammad. Weil der Drogenhandel und bewaffnete Gangs sich zunehmend in Schatila eingenistet hätten, fernab der Kontrolle des Staates, hätte sich das in den Köpfen von Außenstehenden als Ort eingebrannt, den man meiden sollte. »Wenn jemand von draußen hierherkommt«, sagt Mohammad, »was für ein Bild hat er dann von der palästinensischen Sache? Es ist nicht die Olive und die Standhaftigkeit und der Widerstand.« Stattdessen würden sie einen Ort sehen, wo sich alle Verbrecher verstecken würden.
Inzwischen ist Mohammad deswegen zur Überzeugung gelangt, dass er sein Gefühl von Zugehörigkeit nicht mehr an einen Ort binden müsse. »Zugehörigkeit ist kein Ort, keine Flagge oder Zeichnung an der Wand«, sagt er. »Wir können sie selbst schaffen und sie mit uns mitnehmen.«
Dieser Beitrag wurde durch den Liesl Graz Fonds der Schweizerischen Gesellschaft Mittlerer Osten und Islamische Kulturen (SGMOIK) unterstützt.
Der Text basiert auf dem Buch «Beirut – Splitter einer Weltstadt», das am 14. Oktober beim Hirzel Verlag erscheint. Die Autorin stellt das Buch am 30. Oktober um 19 Uhr in der Buchhandlung 1002F (Mille et Deux Feuilles), Glasmalergasse 6, 8004 Zürich, vor.