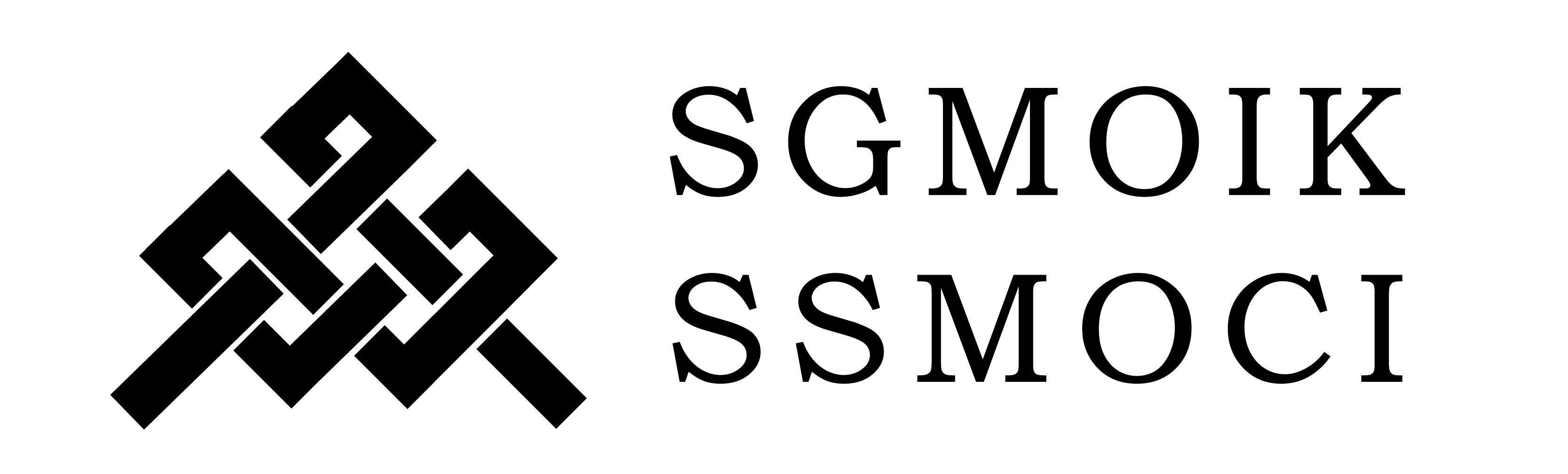Von Nora Togni
«Als die IS-Kämpfer nach Kocho kamen, versammelten sie alle Einwohner:innen des Dorfes in der Schule. Sie sagten uns, wir sollen zum Islam konvertieren oder sterben. Ich war damals zwölf Jahre alt und kann mich an jedes Detail dieses Tages erinnern. Zuerst nahmen sie die Männer mit und fuhren auf die Felder ausserhalb des Dorfes. Von der Schule aus konnten wir die Schüsse hören. Trotzdem wollten wir nicht glauben, dass innerhalb weniger Stunden alle Männer von Kocho umgebracht worden waren.» – Said*
Die Perspektive männlicher Überlebender
Am 3. August 2014 überfiel die Terrormiliz «Islamischer Staat» (IS) die Ezid:innen in Şengal, Sindschar, im Nordwesten Iraks. Sie entführten und versklavten Frauen und Kinder, die Männer richteten sie systematisch hin. Hunderttausende von Ezid:innen flohen über das Şengal-Gebirge, Unzählige starben auf dem Weg an Hunger und Durst. Die traurige Bilanz: Innert kurzer Zeit war ein Grossteil der knapp 500’000 Menschen der ezidischen Gemeinschaft vertrieben worden. Das vom UN-Generalsekretär eingesetzte Ermittlungsteam UNITAD stufte in seinem Abschlussbericht von 2017 die Ermordung, Vertreibung und Versklavung von Ezid:innen im Irak als Genozid ein. Am 17. Dezember 2024 wurde dieser Genozid auch vom Schweizer Nationalrat anerkannt, mit 105 zu 61 Stimmen bei 27 Enthaltungen.
Zedan und Said waren zur Zeit des Massakers vierzehn, respektive zwölf Jahre alt, sie sind dem IS entkommen. Zedan lebt heute im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen, das eine grosse ezidische Bevölkerung beheimatet, Said in Berlin. Ich begegnete Zedan und Said als ich in Deutschland zwischen Oktober und November 2022 für meine Masterarbeit zum Genozid an den Ezid:innen recherchierte. Während meines Forschungsaufenthalts konnte ich mit insgesamt zwölf Überlebenden sprechen – fast alle von ihnen Männer. Das lag in erster Linie daran, dass mir vor allem männliche Kontaktpersonen vermittelt wurden, was ich erst bedauerte. In den Gesprächen wurde mir aber schnell bewusst, wie viele Geschichten die Männer zu erzählen hatten; Geschichten, die in der medialen Berichterstattung bislang kaum Gehör gefunden haben, da die geschlechtsspezifische Erfahrung die Narrative stark beeinflusst. Besonders die grausame Gefangenschaft und sexuelle Versklavung der von IS-Kämpfern verschleppten ezidischen Frauen und Mädchen prägen das Bild des Genozids. So setzt sich etwa Nadia Murad, weltweit bekannt durch ihre Autobiografie «The Last Girl», in der sie von ihrer Versklavung in Mossul erzählt, seit 2016 als UNO-Sonderbotschafterin für die Würde der Überlebenden des Menschenhandels ein. 2018 wurde ihr für ihre unermüdliche aktivistische Arbeit der Friedensnobelpreis verliehen.
Die Geschichten ezidischer Männer sind aber auch deshalb im Hintergrund geblieben, weil die Männer selbst das entsetzliche Leid der Frauen als die tragischste Folge des IS-Angriffs erachten, als die tiefste Wunde des Genozids. «Die Frauen haben am meisten gelitten», sagt Zedan. Seine Schwester gehört zu den rund 2600 Ezidinnen, die noch immer als vermisst gelten. Sie verdeutlichen das Trauma einer Gemeinschaft, deren Leid auch elf Jahre nach dem Massaker kein Ende gefunden hat. Gerade angesichts dessen eröffnen die Gespräche mit den ezidischen Männern eine zusätzliche Perspektive. Aus diesem Grund beschloss ich, sie zu dokumentieren.
Zedan und Said: Erzählungen von Flucht, Verlust und der Suche nach Halt
Ezidische Väter und erstgeborene Söhne tragen die Verantwortung für ihre Familie, auch auf der Flucht oder im Exil. Dies erlebte Zedan, als er sich mit seiner Familie einige Wochen vor dem 3. August 2014 auf den Weg nach Syrien machte. Dass er den Irak noch rechtzeitig verlassen konnte, rettete ihm das Leben. Heute verfolgen ihn die Gedanken, dass er jenen Familienmitgliedern, die zurückblieben, nicht helfen konnte und sie nie mehr sehen würde. Ganz anders verläuft Saids Geschichte: Acht Monate lang hatte er sich als Kind in der Gefangenschaft der Terrormiliz befunden. Er sollte zu einem Kämpfer erzogen und später in den Krieg nach Syrien gezwungen werden. Mehrere Fluchtversuche scheiterten. Doch schliesslich gelang ihm die Flucht nach Kurdistan. Sowohl Zedan wie auch Said kamen 2015 über das in Baden-Württemberg beschlossene humanitäre Aufnahmeprogramm, das sogenannte Sonderkontingent, nach Deutschland. Die beiden hatten Glück. Das Leben, wie sie es aus ihren Dörfern in Şengal kannten, wurde ihnen jedoch irreversibel genommen.
Dem Massaker entkommen
Ich traf Zedan zum Gespräch in einem denkmalgeschützten Wasserschloss in Nordrhein-Westfalen, das zum Zentrum für ezidische Studien und Sitz des deutschen Zentralverbands der ezidischen Gemeinden umfunktioniert worden war. Zedan stammt aus Siba Sheikh Khidir, einem ezidischen Dorf südlich des Şengal-Bergs. 2007 wurde das Dorf Ziel eines Autobombenanschlags, mit 796 Toten und mindestens 1500 Verwundeten war es das tödlichste Attentat im Irakkrieg. Koordiniert hatte den Autobombenanschlag die Terrorgruppe Al-Qaida. Zedan war damals zehn Jahre alt. Das Haus seiner Familie wurde von der Explosion getroffen, eine seiner Tanten starb, sein Cousin verlor einen Fuss.
Als sich die Terroranschläge und die sunnitisch-islamistisch motivierte Gewalt im Irak zunehmend auf religiöse Minderheiten ausweiteten, wurden Ezid:innen vermehrt zum Ziel. Aus Angst um ihre Sicherheit zogen Hunderte von ezidischen Studierenden von der Universität Mosul weg und wechselten zu Universitäten in der kurdischen Autonomiezone; viele Arbeitnehmende in verschiedenen Regionen verliessen ihre Jobs. Das Verhältnis zu den arabischen Nachbarn verschlechterten sich, oft führte der Vertrauensverlust zwischen den benachbarten Gemeinschaften zum Abbruch der Beziehungen. Angesichts dieser steigenden Unsicherheit entschied sich Zedan, mit seinem schwerkranken Vater, seiner Mutter und seinem jüngeren Bruder den Irak zu verlassen. In Rabiaa an der syrischen Grenze wurden sie erst von bewaffneten Gruppen zurückgedrängt, doch beim nächsten Versuch gelang es ihnen, die Grenze zu überschreiten und die Reise fortzusetzen: «Als ich vom Genozid erfuhr, waren wir bereits in Ankara und zunächst dankbar, dass wir dem Massaker entkommen sind», erzählt er. «Doch dann fühlte ich mich schuldig, weil ich nicht bei meinen Leuten geblieben bin. Ich wollte nach Şengal zurück, um mich dem Widerstand anzuschliessen und gegen den IS zu kämpfen. Aber meine Familie konnte mich davon abhalten.»
Die Familie schaffte es nach Amman, wo Zedan einen Job in einem Café fand, mit dem er die bevorstehende Reise nach Europa finanzieren wollte. Doch weil er keine Arbeitsbewilligung hatte, wurde er von den jordanischen Behörden immer wieder verhaftet. Obwohl er damals noch minderjährig war, schlug und misshandelte ihn die jordanische Polizei brutal. Im Gefängnis waren er und andere Migranten aus Irak und Syrien Diskriminierung und Gewalt durch Mitinsassen ausgesetzt. Wie Zedan erklärt, sei es in Jordanien gängige Praxis, illegale Arbeiter zusammen mit Verbrechern einzusperren, um sie davon abzuhalten, ohne Arbeitserlaubnis weiterzuarbeiten.
Während des Aufenthalts in Jordanien starb sein Vater. Zedan kehrte nach Erbil zurück, um die Leiche im Heimatland zu bestatten. Danach setzte die Familie ihre Reise nach Europa fort; fuhr von Izmir aus in einem überfüllten Boot nach Griechenland, es war der erste Schritt entlang der gefährlichen Balkanroute. Auf dem Weg traf Zedan auf andere Ezid:innen, die dem Genozid entkommen waren. Auch seine Frau lernte er auf der Balkanroute kennen. Dies half ihm, optimistischer auf das Leben in Europa zu blicken. In Deutschland durchlief Zedan das Asylverfahren, er und seine Familie erhielten eine Aufenthaltserlaubnis. Doch Şengal liess ihn nicht los. Täglich erreichten ihn neue schockierende Berichte: von Massengräbern, verschleppten Frauen, zerstörten Dörfern. «Fast jeden Tag erfuhr ich vom Tod einer Person meiner Umgebung.» Alle seine Freunde waren ermordet worden, ebenso seine Schwester und deren Familie. Eine Schwester überlebte die Gefangenschaft und kehrte in den Irak zurück, eine andere war mit ihrem Mann in Şengal-Stadt geblieben und vermutlich entführt worden. Von ihr fehlt bis heute jede Spur: «Sie wurde verraten», meint Zedan. «Die schlimmsten Verbrechen sind in der Stadt Şengal begangen worden. Die sunnitischen Einwohner:innen arbeiteten mit dem IS zusammen, sie meldeten den Kämpfern, wer die Ezid:innen waren und wo sie wohnten. So verrieten sie wohl auch meine Schwester: Unter dem Vorwand sie zu schützen, hielten ihre Nachbarn sie davon ab, die Stadt zu verlassen, um sie später dem IS auszuliefern.» Die Ezid:innen hätten die Hoffnung nicht aufgegeben, ihre vermissten Angehörigen wiederzufinden, betont Zedan. Sie seien sich jedoch bewusst, dass kaum ein Staat an ihrem Schicksal interessiert sei. «Sie sind von der internationalen Gemeinschaft im Stich gelassen worden.»
Später sollte Zedan erfahren, wie sich die Peshmerga, die Streitkräfte der Autonomen Region Kurdistan im Irak, während des Genozids kampflos zurückzogen hatten. «Das war für uns der grösste Schock», sagt Zedan. «Mein Vater hatte das bis zu seinem Tod nicht fassen können. Denn zu seiner Zeit wäre es für die Peshmerga undenkbar gewesen, die Zivilbevölkerung sich selbst zu überlassen. Früher hatten die Peshmerga gekämpft, um ihr Land und ihre Rechte zu verteidigen, jetzt kämpfen sie für ihre eigene Interessen.»
Nach Şengal zurückgekehrt ist er nie.
Kinder in IS-Gefangenschaft
Said war zwölf Jahre alt, als der IS ihn aus Kocho entführte, einem Dorf südlich von Şengal, und acht Monate lang gefangen hielt. Als ich ihn in einem Café in Berlin treffe, erkundige ich mich, ob es für ihn nicht zu schmerzhaft sei, über diese Zeit zu reden. «Nach meiner Befreiung wurde ich von verschiedenen internationalen Organisationen detailliert befragt, ich habe meine Geschichte so oft erzählt, dass es für mich kein Problem ist, darüber zu reden. Aber ehrlich gesagt, inzwischen habe ich vieles vergessen.»
Als erstes möchte ich wissen, ob Said während seiner Kindheit Gewalt oder Diskriminierung erlebt hatte. Ezid:innen waren unter dem irakischen Diktator Saddam Hussein unter anderem auf dem Arbeitsmarkt diskriminiert worden. So war es ihnen etwa aufgrund ihrer Religionszugehörigkeit nicht erlaubt gewesen, in der Justiz tätig zu sein. Dies, obwohl Saddam Hussein danach gestrebt hatte, die Religion aus der Öffentlichkeit zu entfernen. Said schüttelt den Kopf. «Kocho war ein kleines Dorf von kaum 2000 Einwohnern», sagt er. «Wir wurden nicht diskriminiert, aber ich kann mir vorstellen, dass Ezid:innen in Şengal-Stadt von Seiten der sunnitisch-arabischen Bevölkerung Diskriminierung erfahren haben.»
In Kocho besuchte Said die arabische Schule. Nach dem Sturz Saddam Husseins im Jahr 2003 konnten Ezid:innen wählen, ob sie auf Kurmanji, der meistgesprochenen kurdischen Sprache, oder auf Arabisch unterrichtet werden wollten, unter dem irakischen Diktator war der Unterricht auf Arabisch für alle obligatorisch gewesen. «Kurmanji sprach ich schon zu Hause, also wollte ich noch Arabisch lernen», erzählt er. Diese Wahl rettete ihm später das Leben: Als er während seiner Flucht aus der IS-Gefangenschaft an einem Check-Point angehalten wurde, gab er sich als Araber aus. Da er die Sprache perfekt beherrschte, glaubte man ihm – und liess ihn passieren.
Am 15. August 2014 war Kocho Schauplatz eines unvorstellbaren Massakers geworden. Nach einer zweiwöchigen Belagerung versammelte der IS alle Einwohner:innen in der Dorfschule und begann, die Männer systematisch hinzurichten. Said befand sich mit seiner Familie unter jenen Bewohner:innen, die nicht hingerichtet werden sollten. Sie ahnten, dass ein Massaker geschehen würde. «Denn die meisten, die sich damals innerhalb weniger Tage dem IS angeschlossen hatten, waren keine fremden Gesichter. Sie waren unsere arabische Nachbar:innen. Wir kannten sie vom Sehen und wussten, wer sie waren. Und wir wussten, dass sie uns umbringen wollten.»
Tatsächlich waren einige Anführer der benachbarten arabischen Clans den IS-Milizen gefolgt und beteiligten sich an dem Massaker gegen die Ezid:innen, mit denen sie zuvor freundschaftliche und wirtschaftliche Beziehungen unterhalten hatten. Die überlebenden Ezid:innen verloren dadurch nicht nur das Vertrauen in jede Behörde Iraks – von der Zentral-, bis zur kurdischen Regionalregierung – sondern auch in ihre Nachbar:innen. Said erzählt, wie die IS-Kämpfer zunächst Männer und männliche Jugendliche ab fünfzehn Jahren auf die Felder ausserhalb des Dorfs verschleppten und einen nach dem anderen erschossen. «Wir wussten, was geschah. Doch wir wollten es nicht glauben, dass alle Männer umgebracht worden waren. Ich habe auch ein Jahr später immer noch gehofft, dass sie irgendwo in Gefangenschaft sind. Manche hoffen das noch heute, obwohl wir mittlerweile die sterblichen Überreste der Hingerichteten aus den Massengräbern ausgegraben haben.»
Said verlor im Massaker von Kocho seinen Vater, fünf Onkel, beide Grosseltern – auch ältere Frauen wurden erschossen und manchmal noch lebendig begraben – alle seine Cousins und seinen besten Freund, der gleich alt gewesen war als er, aber vom IS als «erwachsener Mann» eingestuft und hingerichtet worden war. «Sie haben uns Kinder untersucht, ob wir Haare haben und somit als ‹Männer› galten. Ich wurde auch kontrolliert, dann aber freigelassen. Es war reines Glück: Mein bester Freund ist jetzt tot, weil er erwachsener aussah als ich.»
Erst verkauften die IS-Kämpfer nur die unverheirateten Frauen in Mosul als Sklavinnen, Frauen mit Kindern verschonten sie. Saids Mutter, sein kleiner Bruder, eine schwangere Tante und die Tanten, die auch Mütter waren, überlebten. Said wurde von seiner Mutter getrennt und mit anderen Kindern nach Tel Afar transportiert, eine Stadt 52 Kilometer östlich von Şengal und erneut in eine umfunktionierte Schule gebracht. «Es war ein Gefängnis für Ezid:innen», so Said. «Dort trafen wir diejenigen, die aus anderen Dörfern Şengals entführt worden und bereits seit elf Tagen eingesperrt waren. In diesem Moment haben wir realisiert, dass dies im voraus geplant und orchestriert worden sein muss. Wir waren mindestens fünfzehn Kinder in einem Zimmer, Tag und Nacht. Abends haben uns die IS-Anhänger Koranunterricht erteilt, sie wollten uns zum Islam bekehren.»
Später durften die gefangenen Kinder zu ihren Angehörigen zurückkehren, sie lebten unter strenger Überwachung des IS in Tel Afar. «Wir konnten uns ein leeres Haus aussuchen. Der grösste Teil der Bevölkerung von Tel Afar war geflohen, die Stadt verlassen», erzählt Said. «Wir wussten nicht, wie lange wir in Tel Afar bleiben würden. Stunden, Tage, Monate, Jahre? Wir hatten keine Ahnung.»
Tagsüber musste Said an die Technische Universität in Mosul, die der IS in eine islamistische Schule umgewandelt hatte: «Wir sollten zu Mudschaheddin ausgebildet werden und befanden uns inmitten von Männern, die nichts anderes im Sinn hatten, als zu töten. Wir mussten lernen, wie man einen Menschen umbringt. Wir hatten Angst, zeigten uns aber motiviert und machten mit. Denn wir waren gezwungen, eine Rolle zu spielen, um an diesem Ort überleben zu können.» Das «Training» bestand daraus, Videos von IS-Kämpfern zu studieren, die Menschen abschlachteten. «Wir mussten uns das alles ansehen. Erst war es grauenhaft, aber irgendwann wurde es normal. Trotzdem habe ich meiner Mutter einmal gesagt, dass ich das nicht mehr aushalte. Diese Schule war die Hölle, ich wollte nicht mehr hin.» Die Lehrer, sie nannten sich ‹Scheichs›, waren aus Jordanien und Ägypten, ein anderer kam, wie Said vermutet, aus Saudi-Arabien. «Unter diesen Lehrern gab es nicht einmal einen Iraker.»
Die meisten IS-Anhänger hingegen stammten aus dem Irak, vor allem aus Mosul, es gab aber auch internationale Kämpfer: «Unter uns war einer aus Russland», erzählt Said, «er sprach kein Wort Arabisch. Er setzte sich einfach zu uns und wollte mitmachen. Viele internationale Kämpfer, die sich ‹Daesh›, dem IS, freiwillig anschlossen, hatten sogar vor, in ihren Rängen Karriere zu machen. Sie waren die Schlimmsten.»
Erst nach acht Monaten gelang Said, seiner Mutter und seinem jüngeren Bruder mithilfe eines Schmugglers die Flucht nach Dohuk in die autonome Region Kurdistan. Nach einem Jahr wurden sie in das Sonderkontingent in Deutschland (siehe Anmerkung unten) aufgenommen.
Geschichte einer andauernden Verfolgung
Der Begriff «Genozid» wurde 1944 vom polnischen Juristen Raphael Lemkin als Reaktion auf den Holocaust und den Völkermord an den Armeniern während des Ersten Weltkriegs geprägt. Die UN-Konvention zur Verhütung und Bestrafung des Völkermords von 1948, heute von über 150 Staaten ratifiziert, definiert Genozid als die absichtliche Vernichtung einer nationalen, ethnischen, rassischen oder religiösen Gruppe – sei es durch Tötung, schwere körperliche oder seelische Schäden, unmenschliche Lebensbedingungen, Geburtenverhinderung oder die gewaltsame Trennung von Eltern und Kindern. Obwohl die juristische Aufarbeitung eines Genozids lückenhaft bleibt, und viele Täter weiterhin auf freiem Fuss sind, ist die offizielle Anerkennung eines Genozids entscheidend für die Überlebenden. Sie trägt zur Erinnerungskultur bei und schafft Sichtbarkeit, ermöglicht Strafverfolgung vor internationalen Gerichten und schützt vor Relativierung oder Leugnung. Denn die Überlebenden eines Genozids, so auch jene in der ezidischen Diaspora, leiden bis heute an immensen physischen und psychischen Folgen.
Der 3. August 2014 gilt unter Ezid:innen als der 74. «Ferman». Dieser osmanisch-türkische Begriff bezeichnet die Dekrete der osmanischen Herrscher gegen die Minderheiten ihres Reichs und wird von Ezid:innen verwendet, um die Massaker zu benennen, die sie im Laufe der Geschichte erlitten haben. Die zyklische Erfahrung von Gewalt spielt eine zentrale Rolle in ihrem kollektiven Gedächtnis. Während die Osmanen mit den Massakern an der Gemeinschaft darauf abzielten, die Kontrolle über die östlichen Provinzen aufrechtzuerhalten, rechtfertigten sie die Anwendung von Gewalt per se religiös. In mehreren osmanischen Archivdokumenten werden die Ezid:innen als «Ungläubige», «Apostaten» oder auch «Ketzer» beschrieben.
Das Regime von Saddam Hussein in Irak (1979 bis 2003) verfolgte eine ähnliche Strategie: Die Ezid:innen wurden zusammen mit Kurd:innen, Turkmen:innen und Schabak:innen, eine ethno-religiöse Gruppe im Norden des Irak, Ziel einer Aktion, mit der eine vollständige «Arabisierung» des Landes erreicht werden sollte. Die Baath-Partei unter Saddam Hussein beabsichtigte, den arabischen Charakter des Irak zu stärken, insbesondere durch Zwangsumsiedlungen der nicht-arabischen Bevölkerung. So wurden die Ezid:innen ab den 1970er Jahren aus ihrem ursprünglichen Siedlungsgebiet im Şengal-Gebirge vertrieben und in weit entfernte, eigens zur Zwangsumsiedlung errichtete Dörfer deportiert. Damit verloren die Ezid:innen ihre Ressourcen und primäre Erwerbsarbeit in der Viehzucht und Landwirtschaft, die vom Zugang zu Wasser in den Bergen abhing. Der Genozid von 2014 ist somit Ausdruck einer Kontinuität in einer Geschichte von Gewalt gegenüber der ezidischen Gemeinschaft; doch sind die Ereignisse von 2014 auch eine Zäsur: Im Gegensatz zum osmanischen Kontext zeugt dieses jüngste Massaker von der Absicht, die Ezid:innen als Gruppe zu vernichten und ihre Präsenz in Şengal auszulöschen.
Orientierungslosigkeit und Neuanfang im Exil
Heute liegt Kocho grösstenteils in Trümmern, das Trauma der Ereignisse ist immer noch präsent. Im Gegensatz zu Zedan, ist Said mehrmals in den Irak zurückgekehrt. Das erste Mal 2019, als in Kocho die ersten Massengräber ausgegraben werden sollten. «Ich wollte unbedingt dabei sein. Es war schön, die Leute wieder zu sehen, die den Genozid überlebt haben. 2021 bin nochmals mit meiner Mutter in den Irak geflogen, weil die Gräber, in denen wir die Überreste meines Vaters, meines Grossvaters und meiner Onkel vermuteten, geöffnet wurden. Man fand die Überreste meines Vaters. Ich habe sie mit meinen eigenen Händen begraben.»
In Kocho erinnert ein neuer Friedhof an die Opfer des Massakers. Viele Gräber sind jedoch noch leer, da die Dorfgemeinschaft darauf wartet, dass alle Überreste ihrer Angehörigen exhumiert und identifiziert werden. Said macht sich jedoch keine Illusionen darüber, dass Ezid:innen in Şengal jemals Gerechtigkeit zuteil wird. «Dass sich die irakische Regierung für uns interessiert, kann man vergessen. Das zeigt nur schon, dass wir unsere Familienmitglieder erst nach sieben Jahren in unseren Friedhöfen beisetzen durften.»
In der ezidischen Diaspora in Deutschland, mit 300’000 Menschen die grösste Diasporagemeinde weltweit, herrscht weitgehend eine verbitterte Stimmung, sagt Said. Am meisten enttäuscht ihn die Asylpolitik Deutschlands und die Tatsache, dass der Völkermord an den Ezid:innen und seine offizielle Anerkennung bislang keinen Unterschied in der Aufnahme von Ezid:innen bewirkt hat. Das werde von vielen als «bitteren Affront» empfunden. «In Şengal hat sich die Situation kaum verbessert, das Misstrauen gegenüber der arabischen Bevölkerung ist nach wie vor gross. Wir haben deshalb alles auf eine Karte gesetzt und unser gesamtes Leben zurückgelassen, um hier einen Neuanfang zu wagen.»
Den geflüchteten Ezid:innen fehle es an Zukunftsaussichten, viele befänden sich erneut in einer Phase grosser Orientierungslosigkeit. «Der Wille zum Neustart stösst oft an seine Grenzen, weil die Politik ihre Verantwortung nicht in dem erforderlichen Mass wahrnimmt und die notwendigen Unterstützungsstrukturen bereitstellt», meint Said. «Ezid:innen in Deutschland brauchen raschen Zugang zu kultursensiblen Deutsch‑Intensivkursen, Traumatherapie, kostenfreier Rechtsberatung in Asyl‑ und Aufenthaltssachen sowie eine schnelle Anerkennung ihrer im Irak erworbenen beruflichen Qualifikationen.» Denn oft werden Ezid:innen, die nach 2014 nach Deutschland gekommen sind, mit ezidischen Gastarbeiter:innen der 1960er und 70er Jahre verglichen – eine Erwartungshaltung, die die notwendige Zeit zur Integration ausser Acht lässt. Denn Politik und Verwaltung legen bei allen Migrant:innen ähnliche Integrations‑ und Arbeitsmarkt‑Indikatoren an, zum Beispiel sprachlicher Fortschritt, berufliche Etablierung oder soziale Teilhabe, unabhängig von deren tatsächlichen Aufenthaltsdauer. Das ist irreführend. «So entsteht der Eindruck, die Ezid:innen hätten schon viel erreicht», erklärt Said.
Dennoch versuchen die Ezid:innen, sich in Deutschland Stück für Stück ein neues Leben zu erobern. Zedan hat zwar die Geschehnisse noch nicht verarbeiten können, arbeitet inzwischen jedoch als Journalist und ist als solcher für seine Gemeinschaft engagiert. Dank dieser Tätigkeit hat er seinen Frieden wieder gefunden und fühlt sich seiner Heimat nahe. Die Situation der Ezid:innen aus Şengal in Deutschland erachtet er als stabil. Das politische System und die Bürokratie wären anfangs ungewohnt, doch hätten sich die meisten gut angepasst. Einige haben eigene Unternehmen gegründet oder kleine Geschäfte eröffnet. Gleichzeitig aber, moniert Zedan, bleibe ihre Geschichte in der deutschen Öffentlichkeit weitgehend unsichtbar. Trotz der offiziellen Anerkennung des Genozids durch den Bundestag im Jahr 2023 werden sie noch immer eher als «Ausländer:innen» wahrgenommen und weniger als eine Gemeinschaft, die in ihrer Geschichte mehrere Verfolgungen und einen Genozid überlebt haben. «Nach dem Genozid flohen wir nach Deutschland, um unser Leben zu retten», sagt Zedan. «Doch auch jene, die für den Völkermord verantwortlich waren, kamen hierher. Sowohl die Täter wie auch die Überlebenden wurden mit derselben Offenheit empfangen.»
Diese Gleichbehandlung stellt im Alltag eine Bedrohung für die Ezid:innen dar. Doch weil sie wissen, dass sie in dieser Demokratie geschützt sind und in Freiheit leben können, sind viele motiviert, zu einem festen Teil der Gesellschaft zu werden. Zumal sie in Deutschland neue Chancen haben, wie etwa der Zugang zu Hochschulen und Ausbildungen. In Şengal selbst hatte es keine vergleichbaren Möglichkeiten gegeben.
Said studiert heute Bauingenieurwesen an der TU Berlin. Auch er ist daran, seinen Platz in Deutschland zu finden.
*Zum Schutz des Protagonisten wurde sein Name geändert.
Das Sonderkontingent in Deutschland
Das sogenannte Sonderkontingent umfasste 1000 besonders vulnerable Frauen und Kinder, die nach Deutschland geholt und auf verschiedene Kommunen in Baden-Württemberg verteilt wurden. In Nordrheinwestfalen gab es 2023 einen Abschiebestopp für Ezid:innen, doch der wurde inzwischen aufgehoben. Ein befristeter Abschiebestopp für Frauen und Minderjährige jesidischen Glaubens gilt derzeit unter anderem noch in Thüringen und Rheinland-Pfalz. Grundsätzlich aber werden Ezid:innen wie alle anderen ausländischen Schutzsuchenden behandelt und sehen sich im Fall abgelehnter Asylanträge denselben Abschiebungsverfahren ausgesetzt. Gemäss des «Spiegels» wurden in den ersten Monaten des Jahres 2024 665 Asylanträge von Ezid:innen mit irakischem Pass abgelehnt, was einem Anteil von 56 Prozent entspricht.
Legende Bild in Listenansicht:
Ezid:innen versuchen mit Hilfe eines irakische Helikopters die Flucht aus dem Şengal-Gebirge.
Foto: Botan Gulan, 2014
Nora Togni studierte Kunstgeschichte und Geschichte an der Universität Basel. Nachdem sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin für mehrere Forschungsprojekte im Bereich der Provenienzforschung arbeitete, besuchte sie den Masterstudiengang Mittlerer Osten am Global Studies Institute der Universität Genf. Die Recherchen für ihre Masterarbeit über den Genozid der Ezid:innen führte sie nach Deutschland, wo sie mehrere Überlebende des Genozids interviewt hat. Im Zentrum ihrer Arbeit standen die Fragen, wie Gewalt und Genozid im historischen Kontext der MENA-Region als politisches Instrument verwendet wurden und wie die jahrzehntelange Verfolgung der Ezid:innen den Boden für die Gräueltaten des «Islamischen Staats» bereitete. Zudem ging es ihr darum, zu ergründen, warum die Anerkennung des Genozids für die Überlebendens wichtig ist, und was es für die ezidische Gemeinschaft bedeutet, die bereits eine lange Geschichte der Verfolgung kennt, einen Genozid erlitten zu haben. Derzeit ist sie am Aargauer Kunsthaus im Bereich Sammlungsmanagement tätig.
Weiterführende Literatur
Cheterian V., «ISIS Genocide against the Yazidis and Mass Violence in the Middle East», British Journal of Middle Eastern Studies, vol. 48, Nr. 4, août 2021, p. 629‑641.
Fuccaro N., The Other Kurds: Yazidis in Colonial Iraq, London: I. B. Tauris, 1999.
Gölbaşi E., “Turning the ‘Heretics’ into Loyal Muslim Subjects: Imperial Anxieties, the Politics of Religious Conversion, and the Yezidis in the Hamidian Era”, in: The Muslim world, (vol. 103/1), 2013, p. 3-23.
Kartal C., Deutsche Yeziden. Geschichte, Gegenwart, Prognosen, Marburg: Tectum Verlag, 2016.
Tagay S. & Ortaç S., Die Eziden und das Ezidentum. Geschichte und Gegenwart einer vom Untergang bedrohten Religion, Landeszentrale für politische Bildung Hamburg: Hamburg, 2016.
Tezcür G. M. (éd), Kurds and Yezidis in the Middle East: Shifting Identities, Borders and the Experience of Minority Communities, London: I.B. Tauris, 2021.
TOGNI N., Shengal: une histoire sans fin. Le génocide des Yézidis et la perpétuation de la violence politique en Irak et au MoyenOrient, Mémoire de recherche présenté pour l’obtention de la Maîtrise universitaire «Moyen Orient» par Nora Togni. Rédigé sous la direction de Vicken Cheterian, juré: Ozcan Yilmaz, Genève, août 2023. URL: https://www.unige.ch/gsi/application/files/9717/2647/6231/Togni.pdf
Wettich T., Erkundungen im religiösen Raum: Verortungen religiöser Transformationsprozesse der yezidischen Gemeinschaft in Niedersachsen, Stuttgart: Kohlhammer Verlag, 2020.